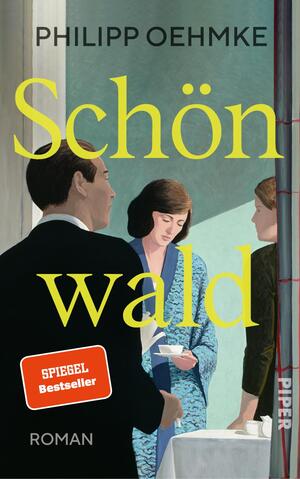

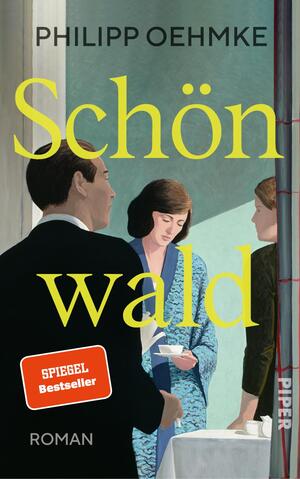
Schönwald Schönwald Schönwald - eBook-Ausgabe
Roman
— Großer Familien-Roman auf der Shortlist des Aspekte-Literaturpreises„Was für eine Familie! Was für ein Buch! Philipp Oehmkes Roman-Erstling gebührt ein Tusch.“ - Ruhr Nachrichten
Schönwald — Inhalt
„Der immer ersehnte, nie gelieferte aktuelle deutsche Gesellschaftsroman, hier ist er.“ Jens Jessen, DIE ZEIT
Eine deutsche Familie, ein großer Roman
Anders als Harry findet Ruth Schönwald nicht, dass jedes Gefühl artikuliert, jedes Problem thematisiert werden muss. Sie hätte Karriere machen können, verzichtete aber wegen der Kinder und zugunsten von Harry. Was sie an jenem Abend auf einem Ball ineinander gesehen haben, ist in den kommenden Jahrzehnten nicht immer beiden klar. Inzwischen sind ihre drei Kinder Chris, Karolin und Benni erwachsen. Als Karolin einen queeren Buchladen eröffnet, kommen alle in Berlin zusammen, selbst Chris, der Professor in New York ist und damit das, was Ruth sich immer erträumte. Dort bricht der alte Konflikt endgültig auf.
„Schönwald“ ist der mitreißende Roman einer Familie und zweier Generationen, die nie gelernt haben, miteinander zu reden – und die ein großes Geheimnis miteinander verbindet.
„›Schönwald‹ ist ein entlarvender, preisverdächtiger Roman, vielleicht sogar ein Buch des Jahres.“ ― WDR 5 „Bücher“
Leseprobe zu „Schönwald“
LESEPROBE
Ruths Qualen
Wenn Ruth im Hotel am Gendarmenmarkt aus dem Fenster blickte, kam ihr der Verdacht, dass das Hotel am Gendarmenmarkt möglicherweise gar nicht am Gendarmenmarkt lag. Jedenfalls vermochte sie nicht zu sagen, in welcher Richtung der Platz sein könnte – geschweige denn, dass sie ihn sähe. Sie hatte versucht, das Fenster zu öffnen, um ihren Kopf mal hinausstrecken zu können, vielleicht waren links und rechts ein paar Hinweise auf die Existenz des Platzes auszumachen, ja womöglich wären gar seine Ränder und Ausläufer in ihr Blickfeld [...]
LESEPROBE
Ruths Qualen
Wenn Ruth im Hotel am Gendarmenmarkt aus dem Fenster blickte, kam ihr der Verdacht, dass das Hotel am Gendarmenmarkt möglicherweise gar nicht am Gendarmenmarkt lag. Jedenfalls vermochte sie nicht zu sagen, in welcher Richtung der Platz sein könnte – geschweige denn, dass sie ihn sähe. Sie hatte versucht, das Fenster zu öffnen, um ihren Kopf mal hinausstrecken zu können, vielleicht waren links und rechts ein paar Hinweise auf die Existenz des Platzes auszumachen, ja womöglich wären gar seine Ränder und Ausläufer in ihr Blickfeld geraten. Die Kuppeln des Deutschen und Französischen Doms zum Beispiel, oder, wenn es die nicht gab, wenigstens sekundäre Hinweise, wie zum Beispiel Fahrradrikschas oder Souvenirläden. Sogar nach einem verstärkten Taubenaufkommen hatte sie Ausschau gehalten.
Doch die Fenstergriffe waren irgendwie blockiert, jedenfalls ließen sie sich nicht drehen. Unten am Hebel hatte Ruth eine kleine Schraube entdeckt, in deren Gewinde sie nun mit ihrer Nagelfeile herumstocherte. Wenn nur ein paar Anzeichen des versprochenen Gendarmenmarkts zu sehen wären, dann würde sie ihren Frieden machen können. Würde eine Großbaustelle auch als Indikator für die Nähe einer der prächtigsten Plätze der Stadt durchgehen? Natürlich kann ein Platz wie der Gendarmenmarkt nach gerade mal dreißig Jahren seit der Wiedervereinigung noch nicht komplett fertig sein, an seine Peripherie würde stets weiter angebaut werden, auch weil der Gendarmenmarkt wegen seiner Nähe zum ehemaligen Todesstreifen immer noch von viel freier Fläche umgeben war.
Deswegen ergab es für Ruth durchaus Sinn, dass alles, was sie aus ihrem Fenster sah, eine Großbaustelle war, die morgens ab zehn nach sieben von einem Treck aus fiependen Kipplastern und Betonmischern angefahren wurde und sie weckte.
Trotzdem hatten Hans-Harald und sie in dem Hotel verlängert. Hans-Harald hatte das übernommen. Seit ihrer Ankunft versuchte er unablässig, mit den wechselnden fremdsprachigen Männern und Frauen an der Rezeption Beziehungen aufzubauen, um sich mit ihnen über regionale Spezialitäten, interessante Umgebungsspaziergänge, die Chance auf Karten für Deutsche Oper und Philharmoniker sowie die Verkehrspolitik des rot-rot-grünen Senats austauschen zu können. Für ihren Mann gehörte diese soziale Anbindung zu der Hotelerfahrung dazu, und auch sie konnte sich an eine Zeit erinnern, in der das mal so war.
Sie hatten ihren Aufenthalt verlängert, weil Karolin, wie sie glaubten, nach dem Angriff auf ihren Buchladen eine schwere Zeit durchmachte, da hatten sie für ihre Tochter da sein wollen. Doch nachdem sie gleich am Sonntagmorgen unangemeldet bei ihr zu Hause aufgetaucht waren, waren sie ihr, abgesehen von zwei kursorischen Treffen, kaum noch begegnet.
Sie hatten überlegt, raus in die Uckermark zu fahren, um wenigstens Benni und die Enkelkinder noch einmal zu sehen, doch es regnete seit Tagen, und die hatten ja auch ihr eigenes Leben dort draußen, plus die komplizierte Emilia. Auch Christopher schien jetzt hier in Berlin sehr beschäftigt. Er meldete sich zwar täglich telefonisch und stellte alle möglichen Szenarien der Wiederbegegnung in Aussicht („Heute Abend lade ich euch ins Grill Royal ein“, ein Lokal, das nach allem, was Ruth am Rande aus Gesprächen zwischen Christopher und Karolin aufgeschnappt hatte, ganz fürchterlich klang, auf das Hans-Harald aber ganz erpicht war, weil er es aus der Süddeutschen kannte).
In Wirklichkeit freuten sie sich nur noch auf Bennis Grillparty. Das war eine handfeste Veranstaltung, bei der alle noch einmal zusammenkämen. Ihr reichte das, und anschließend würden Hans-Harald und sie auch froh sein, in den Zug nach Köln steigen zu können und wieder in ihr wahres Leben entlassen zu werden. Doch Benni machte sich Sorgen über das Wetter, dass es regnen könnte. Ständig rief er an und wollte das Fest absagen. Wegen ein bisschen Regen, das passte eigentlich gar nicht zum verbindlichen Benni.
Papperlapapp, hatte sie ihm am Telefon gesagt und ihn so beruhigen können – wie oft hatten Hans-Harald und sie Gartenfeste veranstaltet, die mehr und minder komplett in der Garage hatten stattfinden müssen, weil es so geregnet hatte (einmal war sogar die Feuerwehr angerückt, weil es so aus der Garage gequalmt hatte), aber das seien doch die Feste, an die man sich heute noch erinnerte.
Bis zur Gartenparty am Mittwoch galt es immer noch, zwei weitere Tage „ihrer schönen Berlin-Woche“, wie es schon bald in Köln heißen würde, rumzukriegen. Um halb neun hatten sie Zeitung (Hans-Harald) und Reiseführer (Ruth) lesend das „reichhaltige“ Frühstück mit Filterkaffee, Aufback-Croissants, Verpackungswurst sowie Industriequark genossen. Damit hatten sie eine Dreiviertelstunde totschlagen können, nun war es Viertel nach neun, und Hans-Harald lag wieder auf dem Bett und guckte, wie die Tage zuvor auch, mehr oder minder durchgängig auf Eurosport Zusammenfassungen, Liveübertragungen, Vorberichte und Analysen der Vorrundenspiele der US Open, bei denen Spielerinnen und Spieler gegeneinander antraten, von denen selbst Hans-Harald noch nie gehört zu haben schien. Wenn Ruth ihn, leicht angesäuert, fragte, wer denn spiele, merkte sie, wie er selbst erst auf der Bildschirmeinblendung die fremdartigen chinesischen oder osteuropäischen Namen lesen musste und sich dann mühte, sie fachmännisch oder zumindest auf den ersten Blick sinnvoll auszusprechen.
Weil Ruth das Liegen auf einem Bett nur in der festgelegten Zeit der Mittagsruhe zwischen 13 und 15 Uhr für disziplinarisch vertretbar hielt, hatte sie es sich auf einem Holzstuhl mit fröhlich gesprenkelten Stoffpolstern bequem gemacht, der zwischen Bett und Fenster stand und aus dem Fundus einer aufgelösten DB-Lounge stammen könnte. Obwohl es erst zehn Uhr am Morgen war, hatte sie das Deckenlicht im Zimmer anknipsen müssen, um das neue Rätsel im ZEIT-Magazin zu beginnen, dessen um die Ecke zu denkende Mechanik sie vor Jahrzehnten durchschaut hatte und das sie in immer kürzerer Zeit löste und damit nicht nur Hans-Harald, sondern auch ihre Kinder beeindruckte, die meist nicht einmal auf eine einzige Antwort kamen.
Später hatten sie ausgestattet mit zwei Regenschirmen, die Hans-Harald dank seiner Kontakte zu den Hotelangestellten nach langem Hin und Her an der Rezeption hatte organisieren können, das Hotel verlassen, um das „fußläufig erreichbare“, wie es im Hotelprospekt hieß, Holocaust-Mahnmal anzusteuern. Das Mahnmal war nicht überdacht, und der Regen störte die Kontemplation. Trotzdem musste Ruth an das angebliche Nazigeld denken, das von der Wolfsschanze gewissermaßen durch ihre Familie bis in die Gentrifizierung Kreuzbergs geflossen sein soll. Beeindruckend, wie Chris die Kritik zum Verstummen gebracht hatte, wenngleich auch richtig war, dass sie ihren Sohn bei der Instagram-Diskussion eigentlich nicht wiedererkannt hatte, na ja, der Zweck heiligte die Mittel.
Sie liefen weiter nach Süden zur „Topografie des Terrors“ – wenn schon, denn schon, hatte Hans-Harald gesagt –, auch dort befanden sich Teile der Ausstellungsfläche im Freien, zum Glück aber auch einige in geschlossenen Räumen. Die Ausstellung brachte nichts Neues, wie auch, Ruth hatte Neuere Geschichte studiert und Hans-Harald jedes Buch von Sebastian Haffner über das Dritte Reich gelesen, dessen große Hitler-Biografie sogar mehrmals, „ein ganz kluger Mann“, sagte Hans-Harald immer über ihn, genauso wie über Peter Scholl-Latour, zwei Leuchttürme der bundesrepublikanischen Geschichtsschreibung. Ruth erschienen die Texte der beiden immer zu populistisch, Werk und Auftreten zu selbstverliebt. Sie hatte lieber Golo Mann gelesen, das drittälteste Kind des großen Thomas, dessen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ihr präziser und unprätentiöser erschien als die Werke der von Hans-Harald geschätzten TV-Stars.
Ruth grub ihr Telefon aus ihrer Handtasche aus und rief bei Karolin an. Es war immerhin schon zwölf Uhr, sie hatten sich jetzt den gesamten Vormittag selbst beschäftigt, vielleicht wäre es in Ordnung, jetzt mal anzurufen. Karolin ging nicht ran. Dafür kam wenig später eine Textnachricht von Christopher – Vielleicht Kaffee heute Nachmittag? –, und Ruth schrieb sofort Gern! zurück und fügte das Emoji einer dampfenden Kaffeetasse hinzu sowie das eines Stück Kuchens. Die Bildchen kamen ihr selbst verblödet vor, doch sie simulierten Lockerheit. Sie wusste, dass Christopher es gut meinte; dass ihr ältester Sohn sich auf eine fast zwanghafte Weise immer verpflichtet zu fühlen schien und deswegen Ankündigungen machte, denen er meist nichts folgen ließ, so wie sicherlich auch an diesem Nachmittag. Ruth hatte Verständnis, er hatte doch immer so viel zu tun als Literaturwissenschaftsprofessor … obwohl: obwohl sie in letzter Zeit ein paarmal darauf angesprochen worden war, ob Christopher eine neue Stelle hätte, vor allem von Margot Schuler, die ja immer glaubte, besonders gut über die Kultur- und Geisteswelt informiert zu sein, Margot jedenfalls meinte, im Internet etwas dazu gelesen zu haben, das sei aber auf Englisch und ihr deswegen nur in groben Zügen verständlich gewesen. Ruth hatte mit einiger Mühe der Versuchung widerstanden, selbst Christophers Namen bei Google einzugeben. Er hätte bestimmt etwas gesagt, wenn er glaubte, es gäbe etwas, wovon Hans-Harald und sie Kenntnis haben sollten. Solange das nicht der Fall war, wollte sie lieber keine Details wissen. Hans-Harald hatte sie das Gerücht, mehr war es ja nicht, bewusst verschwiegen, weil er ganz sicher sofort das Internet durchkämmt hätte. Wobei, hatte er ihr nicht stolz erzählt, er wolle für alle drei Kinder einen Alarm bei Google einrichten, sodass fortan nichts mehr verpasst würde, was das Internet über die drei Kinder zu berichten wusste? Dann müsste er eigentlich von den Gerüchten gehört haben, und hätte seinerseits ihr nichts von ihnen berichtet – warum, das würde sie noch herausfinden müssen (wahrscheinlicher war allerdings, dass es ihm gar nicht erst gelungen war, den Alarm einzurichten).
Jetzt, auf jeden Fall, waren in New York Semesterferien und es schien nicht ungewöhnlich, dass Christopher mehr als eine Woche in Berlin verbringen konnte.
Wenn das heute Nachmittag, wie sie vermutete, nicht klappte mit dem Kaffeetrinken, wenn er sich da wieder zu viel vorgenommen hatte, würde sie nicht traurig sein. Man säße ja doch nur wieder in einem von Christopher ausgewählten, zu lauten Café, wo sie ihren Cappuccino auf Englisch würde bestellen müssen. Hans-Harald und sie – zwei um die Achtzigjährige in bunten Joggingschuhen mit Umhängetasche und Regenschirm des „Hotels am Gendarmenmarkt“ – wären dort unter den aus Dublin, Toronto und Stuttgart zugezogenen Millennials so fehl am Platz, wie sie steif auf unbequemen Hockern sitzend, ihren Kaffee genössen, während sie immer noch wütend wäre über die vier Euro fünfzig, die der Cappuccino dort kostete, plus fünfzehn Prozent Trinkgeld, das man gezwungen war zu entrichten, sofern man nicht auf dem zum Bezahlen vorgehaltenen iPad explizit das Tastenfeld „No Tip“ wählte, was Hans-Harald in dem hektischen Bezahlvorgang wahrscheinlich nicht gelungen wäre.
Da sich wegen der unsicheren Christopher-Verabredung nun erneut ein unüberschaubares Feld an freier Zeit vor ihnen auftat, hatte Ruth auf ihrem Telefon eine Route ausgeklügelt, die sie von der Topografie des Terrors zum Potsdamer Platz führte, wo sie die U2 zum Bahnhof Zoo nehmen konnten, um von dort den Diener Tattersall fußläufig anzusteuern, ein Restaurant, von dem Hans-Harald behauptete, es während seiner Studienzeit oft besucht zu haben, was Ruth bezweifelte: „Hans-Harald, das ist und war immer ein teures Prominentenlokal“ – für Ruth die größtmögliche Herabwürdigung –, „ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir das als fünfundzwanzigjähriger Jurastudent in der Nachkriegszeit hast leisten können.“
„Es waren die Sechziger“, hatte Hans-Harald entgegnet, „die Sixties, Ruth. Nicht die Nachkriegszeit. Ich hatte sogar einen Mercedes. Im Gegensatz zu dir, die angeblich in Armut aufgewachsen ist, bevor wie uns kannten, hatte ich eine komfortable Jugend und konnte mir leisten, in eine schummrige Berliner Pinte zu gehen, die damals sicherlich kein Prominentenlokal gewesen ist.“
Mit großer Geste hatte er sich beim Diener dann Soleier, Buletten und Kartoffelsalat bestellt, dazu ein Berliner Kindl, und endlich traf er auf jene Art redselige Berliner Servicekräfte, die er im Hotel all die Tage vergeblich gesucht hatte. Ruth hatte einen Salat gegessen und ein kleines Sprudelwasser bestellt („Ruth, hier bestellt man doch keinen Salat!“), und als sie damit fertig waren, war es fünf nach zwei.
Es war schön, in Berlin zu sein, die Idee war gut, ein Geschenk, dass zwei der Kinder hier, oder, in Bennis Fall, in der Umgebung lebten, die Enkel hier waren und sich somit auch Ruths und Hans-Haralds Leben ein bisschen in die Hauptstadt verlagerte. Ruth wusste, dass das nicht allen ihrer Freunde im Rheinland gefiel. In ihrem Freundeskreis, in dem das Aufkommen pensionierter Bundesbeamter, Ministerialdirektoren, Kanzleramts-Referenten relativ hoch war, gab es immer noch einige – wie hatte Christopher sie neulich auf seine unnachahmliche Art genannt? – „Never-Berliner“, die sich bis heute weigerten, jene Stadt zu bereisen, die ihnen 1992 nach heftigen Debatten im Bundestag den Hauptstadttitel weggenommen hatte.
Ruth konnte sich genau vorstellen, wie hinter ihrem Rücken geredet wurde.
„Wo sind denn die Schönwalds? Ach, wieder in Berlin? Was die da immer wollen, ist doch so schäbig da.“
„Ja, als ich anrief, war die S-Bahn gerade ausgefallen, und sie saßen im Schienenersatzverkehr-Bus, der aber natürlich auch nicht losfuhr, und keiner wusste, wann und warum.“
„Da haben sie ja noch Glück, wenn der Bus nicht mit Böllern beschossen wurde.“
„Benni und Karolin, das waren doch eigentlich ganz vernünftige Kinder, warum mussten die denn ausgerechnet nach Berlin? Wenn sie schon wegwollten, hätten sie doch nach Frankfurt oder Düsseldorf gekonnt. Da ist auch kunstmäßig viel los, da muss man nicht nach Berlin für. Die Karolin ist doch so ’ne Kunstinteressierte.“
„Ja, aber die ist ja wohl auch ein bisschen schwierig, da ist ja doch so ein Thema mit Sexualität. Die ist ja mit ’ner Frau zusammen, ne, so was geht natürlich in Berlin besser.“
„Und der Benni, der hat doch einfach reich geheiratet, da in Brandenburg, oder wo das ist? Wohnt da fett auf dem Land.“
„Aber wir waren doch als junge Leute auch in Berlin gewesen! Ich bin da dem Sarg von Benno Ohnesorg hinterhergelaufen!“
„Ach, komm!“
„Natürlich!“
„Ja, Westberlin. Das kannste nicht vergleichen.“
„Die Ossis, puh! Bis heute nichts besser geworden. Deswegen funktioniert da in der Verwaltung ja auch nichts. Das ist immer noch DDR.“
„In den Supermärkten in Berlin gibt es bis heute ja auch keine frische Fleischtheke, weil die Ossis das nicht kennen. Dafür musste ich in Berlin in einen Feinkostladen!“
„Der einzig erfolgreiche der Schönwald-Kinder ist doch der Professor, der Christopher, oder?“
„Ja, aber der ist in New York! Da hast du auch nichts von den Enkeln.“
„Gut, der scheint da auch nicht zu Potte zu kommen, was die Enkelproduktion betrifft. Und der muss doch auch bald fünfzig sein!“
„Wir werden alle nicht jünger. Noch eine Runde Kölsch?“
So oder so ähnlich stellte Ruth sich vor, dass geredet würde, manchmal nachts, wenn sie nicht schlafen konnte und sie in Berlin waren.
Früher hatte Karolin ihnen auch mal ein Airbnb in Kreuzberg gebucht, aber das war für Ruth überhaupt nichts gewesen, sich in den zugerümpelten und allenfalls oberflächlich gereinigten Wohnungen anderer Leute aufhalten zu müssen. Es hatte sich angefühlt, als sei sie aus ihrem Leben geschmissen worden und müsse nun in der Kulisse anderer Leute wohnen. Hans-Harald hingegen hatte es gut gefallen. Er mochte es, in den fremden Regalen herumzustöbern, hier eine mit einem handbeschriebenen Pflaster („Privat!“) beklebte Schublade aufzumachen, dort eine Fotografie umzudrehen, ein Buch durchzublättern und nach Notizen zu durchkämmen, und so gewissermaßen Schritt für Schritt zu ermitteln, was die Leute dort für ein Leben führten. Er wusste aus jahrzehntelanger Arbeit, wie schwierig, beinahe unmöglich es war, Orte von den Spuren ihrer Bewohner zu befreien. Fast alles kann ein Hinweis sein, man muss ihn nur sehen. Und verknüpfen mit anderen Zeichen, die vorerst nicht zusammenzupassen schienen. So entstehe Wahrheit. „Eigentlich skandalös“, sagte er zu Ruth, „was die Menschen einem zumuten zu wissen.“
Von ihr könnten sie ruhig alles wissen, sagte Ruth. Was gäbe es denn bei ihr, und ehrlich gesagt auch bei Hans-Harald und überhaupt bei den meisten Leuten herauszufinden? Wer die Spuren aus ihrem Leben zusammenzusetzen versuchte, würde vor lauter Langeweile sterben. Der Hype um die Privatsphäre und den Datenschutz sei immer schon übertrieben gewesen, die Leute überschätzten die Interessantheit ihres eigenen Lebens. Das meiste, was Menschen hervorbringen, sei eben banal. Der große Erfolg des Reality-Fernsehens, später der sozialen Medien, sei daher eins der unerklärlichen Phänomene unserer Zeit. Insofern, hatte sie Hans Harald gesagt, frage ich mich, was dich an diesen Täterprofilen, die du da erstellst, so interessiert. Andererseits hatte Hans-Harald schon in den unschuldigen Jahren vor dem Internet seine Kinder beim Abendessen nach ihren Freunden befragt und nach deren Eltern, was die so machten, wo sie wohnten. Es ging da nicht um Status, dafür hatte Hans-Harald keinen Sinn. Es war auch keine Neugier, es war echtes Interesse. Wenn es keine Antworten gab zu Adresse oder Beruf der jeweiligen Eltern, war Hans-Harald aufgestanden vom Esstisch, was nur in Ausnahmefällen erlaubt war, und hatte aus dem untersten Bücherregal im Wohnzimmer das damals gelbe Telefonbuch geholt und beinahe genüsslich mit den Worten: „Wollen wir doch mal sehen“, aufgeschlagen und mit einem leicht mit Spucke benetzten Zeigefinger in den dünnen Seiten des Telefonbuchs geblättert.
Während Ruth die Anonymität des Hotels am Gendarmenmarkt gern noch verstärken würde (und, ja, es kam ihr entgegen, dass die meisten Rezeptionsmitarbeiter kein belastbares Deutsch sprachen), arbeitete Hans-Harald unermüdlich gegen sie an. Er wollte, wenn es ginge, gern alles wissen über die Leute hinter dem Tresen der Rezeption und über ihre Ansichten zur Welt, zum Wetter, zum Verkehrschaos in Berlin.
Hans-Harald hatte auch vorgeschlagen, jetzt, wo sie so viel Zeit in Berlin hatten, vielleicht Rainer zu besuchen, immerhin ihr Schwiegersohn. Karolin hatte erzählt, dass das Schönwald’s inzwischen einen Michelin-Stern besaß und man seinen Tisch mindestens zwei Monate im Voraus buchen musste.
„Na ja, für uns wird er ja wohl was haben“, hatte Hans-Harald gesagt. „Das will ich doch schon meinen. Trägt immerhin meinen Namen, das Restaurant.“
„Hans-Harald, da wäre ich mir nicht so sicher. Wir haben uns doch über zehn Jahre nicht gesehen. Und das ist ja auch nicht im Allerbesten auseinandergegangen.“
„Warum ist es eigentlich auseinandergegangen?“
„Ach, lass das doch jetzt. Das spielt doch überhaupt keine Rolle mehr. Ich bin mir jedenfalls sicher, wir sind bestimmt die Letzten, die Rainer in seinem schicken Laden sehen will. Wir sind Ballast aus der Vergangenheit.“
„Aber Ruth, wir sind doch kein Ballast! Im Gegenteil, ich würde sogar erwarten, dass er uns dort mal einlädt. Wie gesagt, das ist immerhin mein Name und der meiner Familie. Wir gehen da jetzt hin, wollen wir doch mal sehen.“
Zum Glück machte das Schönwald’s erst um 19 Uhr auf, sodass Ruth noch ein wenig Zeit blieb, ihrem Mann die Idee, das Restaurant ihres ehemaligen Schwiegersohns zu besuchen, wieder auszureden. Vorher wollte er noch in eine Ausstellung, von der Christopher ihm erzählt hatte, eine Retrospektive der Performancekünstlerin Marina Abramović in der Neuen Nationalgalerie. Christopher kannte die Künstlerin und ihre so gewagten wie oft schmerzhaften Arbeiten aus New York und hatte die Ausstellung sehr empfohlen, sei „mal was anderes“, so hatte Hans-Harald die Worte des Sohnes wiedergegeben. Doch Ruth fühlte sich ob des Dauerregens klamm, die Füße feucht in den Joggingschuhen, sie wollte in die S-Bahn zum Hotel steigen, anstatt in überfüllten und dampfenden Bussen zur Nationalgalerie zu gondeln. Von Hans-Harald, wusste Ruth, war kein großer Widerstand zu erwarten, wenn sie sich sperrte. Außerdem war er – natürlich – müde von all den Buletten und dem Bier, zudem ebenfalls nass. Er sagte, er würde sich auf eine lange heiße Dusche im Hotel freuen sowie anschließend auf ein Tennismatch bei Eurosport. Danach, hatte er angekündigt, würde er wieder fit sein, um Rainers Sternerestaurant einen Besuch abzustatten, was Ruth immer noch für keine gute Idee hielt. Doch Hans-Harald hatte bereits seine Freunde an der Rezeption beauftragt, ihn dort anzukündigen, und zwar bei Rainer Schönwald persönlich, dass ein „gewisser Harry Schönwald“ sich spontan entschieden habe, das Lokal an diesem Abend zu beehren, und das auch zur Not allein, wie er mit einem Seitenblick auf Ruth noch hinzufügte.
Was überhaupt nicht zu Hans-Harald passte und Ruth seit Jahrzehnten irritierte, waren seine ausgedehnten Duschgänge. Früher hatte er gesagt, er könne dort am besten nachdenken, viele seiner Plädoyers hatte er angeblich unter einer heißen Dusche konzipiert.
Ruth hatte entgegen ihren eigenen Regeln die Zeit genutzt, um sich, solange Hans-Harald im Badezimmer sein würde, auf dem Bett kurz auszustrecken. Eurosport lief ohne Ton, anhand von eingeblendeten Statistiken wurden ihr offenbar die Kontrahenten der kommenden Begegnung vorgestellt, das hätte Hans-Harald sicherlich interessiert. Sie drückte auf der abgegriffenen Hotel-Fernbedienung die Lautstärke vorsichtig hoch und lauschte. Wenn Hans-Harald gleich frisch geduscht aus dem Badezimmer käme, würde sie ihm die Erkenntnisse über die Spieler zusammenfassen können. Das würde ihn freuen.
Christopher hatte angeboten, ihnen in seinem Hotel am Zoo auch die Friends & Family-Rate zu besorgen, doch die Zimmer dort verfügten offenbar, wenn sie Christopher richtig verstanden hatte, über keine Badezimmer. Stattdessen stünden da riesige Duschen mitten im Raum. Das war ihr nach mehr als fünfzig Ehejahren doch zu wenig Privatsphäre.
So hörte sie das Prasseln des Duschwassers nur entfernt aus dem Badezimmer, der Geruch von parfümiertem Hotelduschgel kroch durch die Türschlitze, die Schlieren draußen an der Fensterscheibe brachen das gelbe Blinklicht, das von der Baustelle kam; sie hörte gedämpft die Stimmen der Bauarbeiter, die dem Regen trotzend zusammenpackten und nach und nach ihre Lkws starteten. Ruth hatte ihre feuchten Strümpfe ausgezogen sowie die Jeans und beides auf die kalten Heizkörper gelegt; der starke Spätsommerregen verdunkelte die Welt da draußen, hier drinnen hatte Ruth ihre blaue Bluse über die grelle Energiesparbirne der Nachttischlampe gehängt. Angesichts dieses Zusammenspiels aus Duschgeplätscher, Fernsehton, gedämpftem Baustellenlärm, dazu die bunten Lichtbrechungen in der Scheibe, der Wolkenfinsternis da draußen und dem gedimmten Schein der Nachttischlampe musste Ruth sich eingestehen:
Es war gemütlich.
Es war friedlich.
Es war der erste durch und durch angenehme Moment dieser Reise. Sie inspizierte die Minibar, auch hier gab es Berliner Kindl. Behutsam nahm sie eine der beschlagenen Flaschen heraus, während sie darauf achtete, keinen der anderen Gegenstände in dem Kühlschrank auch nur zu berühren, um sie nicht bezahlen zu müssen. Jede Flasche wurde, einmal der Minibar entnommen, sofort aufs Zimmer gebucht, hatte sie in einem ihrer Verbrauchermagazine gelesen, dementsprechend umsichtig musste sie vorgehen.
Sie öffnete das Bier, goss es in eins der beiden über dem Kühlschrank stehenden Gläser und stellte es auf Hans-Haralds Nachttisch. Vielleicht würde Hans-Harald sich zu ihr legen, wenn er geduscht aus dem Bad kam, und sie würden zusammen den ersten Satz schauen; vielleicht würde auch er es gemütlich finden.
Sie überlegte. Dann stakste sie zurück zur Minibar, zögerte noch einmal kurz – alles, was entnommen wird, muss bezahlt werden –, öffnete die Tür und zog, erneut vorsichtig, eine kleine Flasche österreichischen Riesling heraus. Ruth wog die Flasche in ihrer Hand. Drehverschluss.
In dem Moment störte eine Rockmusikmelodie die Harmonie. Es war der Anfang von „Smoke on the Water“, sie kannte es von WDR2. Neben dem Bierglas blinkte es. Es war Hans-Haralds Handy, und Hans Haralds Handy war ebenfalls die Quelle der Rockmelodie. Ruth erinnerte sich, ein Tennisfreund hatte sie ihm als Klingelton eingestellt, und dann hatte Hans-Harald nicht gewusst, wie man das wieder rückgängig machte. Aber eigentlich störte es auch nicht, da Hans-Haralds Telefon so gut wie nie klingelte. Außer ihr und den Kindern hatte, soweit Ruth wusste, niemand die Nummer, und die Kinder riefen nie an, sie hatten sich angewöhnt, es lieber sofort bei Ruth zu versuchen, die wusste, in welche Richtung man den Balken wischen musste, um ranzugehen.
Ruth lief misstrauisch einmal um das Bett herum, von ihrer Seite auf Hans-Haralds, schob sich zwischen Bett und Minibarschrank hindurch und erreichte Hans-Haralds Nachttisch. Unterwegs hatte sie schnell einen Blick auf ihr eigenes Telefon geworfen, sicherlich hatte Christopher, Karolin oder Benni es erst vergeblich bei ihr versucht. Doch sie hatte keinen verpassten Anruf. Und auf dem Display von Hans-Haralds immer noch das Riff von „Smoke on the Water“ spielendem Handy stand weder Chris (wie Hans-Harald seinen Sohn sicherlich eingespeichert hatte) geschrieben noch Karolin (die Hans-Harald eigentlich nie anrief, sondern immer nur Ruth) oder Benni (der noch die naheliegendste Lösung gewesen wäre) – ja gewesen muss es heißen, denn auf dem Display stand keiner dieser Namen, sondern der Name HAUSBRUCH, eingespeichert in Versalien, ob versehentlich oder aus Akzentuierungsgründen.
Hausbruch war nun der Nachname von Martin. Ihrem Doktorvater und Mentor und einiges mehr aus Hamburg, der Professor Hausbruch oder HAUSBRUCH. Dass der Hans-Harald anrief war … sie wollte bedenklich sagen, aber was auf Hans-Haralds Handy zu sehen war, war nicht bedenklich, sondern absolut gefährlich.
Es war potenziell existenzvernichtend.
Ihre Gedanken beschleunigten sich, es wurde auch Zeit, eine Entscheidung musste getroffen werden innerhalb der nächsten Sekunden. Also, noch mal: Martin rief Hans-Harald an, der Ex-Liebhaber den Ehemann, das bedeutete, die beiden kannten sich, sie waren in Kontakt, wie konnten die sich kennen? Und wenn die sich kannten, dann doch sicherlich, weil Martin Hans-Harald alles erzählt hatte, ihr Mann also schon wer weiß wie lange alles wusste, aber nie etwas gesagt hatte. Rangehen, ja oder nein, gleich würde „Smoke on the Water“ verebben, und es wäre zu spät, dann lieber schnell abheben, Martin anschreien, ob er von Sinnen sei, ihren Mann anzurufen, das war gegen die Abmachung, das hatten sie sich immer versprochen. Martin verbieten, je wieder anzurufen, den Anruf aus dem Telefonspeicher löschen, so tun, alles wäre er nie erfolgt, und hoffen, dass alles so bleiben würde, wie es war. Wenn Hans-Harald es wusste und vielleicht auch schon lange wusste, aber bisher nichts daraus hatte folgen lassen, dann würde vielleicht wirklich nichts passieren, die Oberflächen-Realität sich nicht ändern.
Dann hatte die Melodie aufgehört. Es war still geworden. Die Baustelle draußen verstummt; das Duschwasser verebbt; der Regen nachgelassen. Sie musste jetzt schnell sein. Hans-Harald würde gleich mit einem Hotel-am-Gendarmenmarkt-Handtuch umwickelt aus dem Bad kommen, um im auf dem Laminatboden aufgeklappten Koffer nach seiner Unterwäsche zu suchen. Sie wusste, was sie zu tun hatte. Zum Glück war sie mit diesen Samsung-Geräten inzwischen so gewandt. Sie tippte auf den Hinweis Verpasster Anruf, dann auf den Namen HAUSBRUCH, öffnete den Telefonbucheintrag, notierte die Nummer auf dem Hotel-Notizblock (sie selbst hatte die Nummer vor Jahrzehnten weggeschmissen), riss den Zettel ab, faltete ihn und legte ihn in ihr Reisenecessaire. Dann löschte sie den verpassten Anruf aus dem Telefonspeicher und hatte nur noch eine Entscheidung zu treffen: Sollte sie besser die ganze Nummer aus Hans-Haralds Telefon entfernen? Er würde bemerken, dass der Kontakt verschwunden war, aber er würde es auf seine eigene technische Inkompetenz zurückführen. Das wäre die kurzfristig sicherste Variante. Andererseits würde jede Veränderung, wie das plötzliche Verschwinden einer Telefonnummer, automatisch Dynamik in die Sache bringen, Hans-Harald würde vielleicht versuchen, sich die Nummer neu zu besorgen, würde, wo immer er sie herhatte, andere Leute um sie bitten. Sie hörte Gepolter aus dem Badezimmer und legte das Handy schnell hin.
„Oh, gibt es was zu feiern?“, fragte Hans-Harald mit Blick auf das eingegossene Bier und die halb geöffnete Rieslingflasche, die einsam auf dem Sideboard neben der Minibar stand.
„Nein, ich dachte nur, du freust dich (wahrscheinlich dachte er jetzt: ›Das machst du doch sonst nie. Das hast du doch sicher nur für deinen Professor gemacht, Bier im Bett und so.‹)“
„Ja, danke!“ (Komischerweise schien er sich ehrlich zu freuen.)
„Du willst ja dein Spiel gucken, oder? Kommst du eine Stunde ohne mich zurecht? Ich gehe kurz ins Fitnesscenter und mache meine Übungen“, sagte sie und stürzte vor lauter Scham aus der Tür.
„Willst du nicht dein Sportzeug anziehen?“
„Ziehe mich unten um“, rief sie durch die zufallende Tür von Zimmer 217. Sie hatte gar keine Sportsachen dabei, hoffentlich würde das Hans-Harald nicht auffallen. Sie hatte sofort rausgemusst, unmöglich, jetzt in Hans-Haralds Gegenwart zu existieren. Sie musste nachdenken. Was genau wusste Hans-Harald, wussten die Kinder etwas? Warum merkte sie Hans-Harald nichts an? Normalerweise konnte sie alles aus seinem Gesicht lesen, es gab kaum jemanden, der seine Stimmungen schlechter maskieren konnte als ihr Mann. Fand er es vielleicht nicht schlimm? Hatte er gar Verständnis für sie? Sowohl für die Tat an sich, wie auch für das jahrzehntelange Lügen? Ersteres vielleicht, Letzteres ausgeschlossen.
Im Fitnessraum war niemand um diese Uhrzeit. Ruth setzte sich in ihrer Straßenkleidung auf ein Peloton Bike. Hi, bist du bereit für deinen Challenge?, fragte der augenblicklich zum Leben erwachte Monitor. „Danke, ich bearbeite gerade schon genügend Challenges“, murmelte Ruth und war sogleich erschreckt über sich selbst. Hatte sie gerade mit einem Fitnessbike gesprochen?
Sie spürte keine Schuld. Sie hatte das Richtige getan, sie hatte ihr Leben in Sicherheit gebracht mit der Beziehung zu Martin. Und damit ihre Ehe und die mentale Gesundheit ihrer Kinder. Es war doch an den Kindern ihrer Freunde abzulesen gewesen, wie schwer sie die Trennung der Eltern getroffen und aus der Bahn geworfen hatte. Christopher war in den gefährlichsten Jahren Mitte der Achtziger, als sie aus Hamburg nach Köln zurückkehrte, gerade in die Pubertät gekommen. Eine Trennung, was die Alternative zu der Beziehung mit Martin gewesen wäre, und Christopher hätte sicherlich begonnen, Haschisch zu rauchen wie Sven, der Sohn von Helmut und Christa König, er wäre in der Schule abgerutscht, hätte das Gymnasium mehrfach gewechselt, immer mehr Joints geraucht, sich schwarz angezogen und mit seinen neuen Freunden von der Realschule rauchend am Busbahnhof herumgestanden. Er wäre in die Kneipen in der Nähe des Bahnhofs gegangen, von denen sich einige gezielt an schwänzende und abrutschende Oberstufenschüler richteten, mit Happy Hours um 16:30 Uhr und auf Schüler spezialisierten Haschischdealern, die in den engen Gängen zu den Toiletten standen.
Diese oder ähnliche Szenarien hatten in den Achtzigern alle Eltern Westdeutschlands vor Augen. Sie alle hatten Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen und waren beeindruckt von der Gefahr, die offenbar ihren Kindern drohte – die wiederum ein paar Jahre später das Buch im Wohnzimmerregal entdeckten und von der Lektüre nicht abgeschreckt, sondern geradezu animiert sein würden.
Christopher hätte vielleicht noch mit Ach und Krach das Abitur geschafft (aber auch nur, weil es zu jener Zeit nahezu unmöglich war, in Nordrhein-Westfalen durchs Abitur zu fallen), mit dem gerade noch genügenden Dreisechser-Schnitt, nur erreicht durch Fächer wie Sport und Kunst, die mit in die Wertung flossen. Eine unmittelbare Aufnahme des Studiums wäre in den Neunzigerjahren angesichts der überfüllten Universitäten und dementsprechend hohen Numeri clausi nicht möglich gewesen, weswegen Christopher nach halb garer Wehrdienstverweigerung und einem schluffigen Zivildienst erst mal angefangen hätte, bei WOM hinterm Bahnhof zu jobben. Mit dem dort erstmals selbst verdienten Geld hätte er bei seinem Stammdealer größere Mengen Haschisch erwerben und alles, was seinen eigenen Konsum überstieg, an die Kollegen bei WOM weiterverkaufen können. Weil inzwischen Deutschland vom Technoboom erfasst worden war, hätte es bei Christophers Dealer auch Ecstasy und Speed gegeben, was er ebenfalls an die WOM-Leute „weitervertickt“ hätte, wie er es später vor Gericht nennen würde. Die Menge, mit der Christopher dann eines Morgens vor der Arbeit erwischt worden wäre, hätte nur durch Zufall die Schwelle zur Vorstrafe gerade noch unterschritten. Doch die Erfahrung hätte eine ohnehin latent schlummernde Depression in ihm zu voller Entfaltung gebracht. Nachdem WOM ihm gekündigt hätte, wäre seine mentale Verfassung zu schlecht gewesen, um das lang geplante Studium noch aufzunehmen, die letzte Hoffnung seiner geschiedenen Eltern, die mit ihrem „jeweils neuen Partner“ den Problemfall Christopher besprachen, woraufhin es die jeweils neuen Partner nur gut meinten und Christopher zu „einer Flasche Bier“ (Ruths neuer Partner) oder zu „einem Milchkaffee“ (Hans-Haralds neue Partnerin) einluden, was bei Christopher krasse Ablehnung beider jeweils neuer Partner hervorrief (vor allem gegenüber Ruths neuem Partner, denn sie war ja schuld, sie hatte ja die Familie verlassen für diesen Professor in Hamburg). Natürlich belastete Christophers Ablehnung die neuen Beziehungen und führte letztlich dazu, dass sie in die Brüche gingen. Mit Anfang dreißig würde es Christopher schließlich gelingen, seine psychische Abhängigkeit vom THC zu überwinden, und er lernte eine Frau kennen, die als Beamtin auf unterer Besoldungsstufe in einem Ministerium arbeitete. Sie zogen in eine Wohnung am nördlichen Stadtrand, wo Ruth und Hans-Harald ihn bis an ihr Lebensende manchmal getrennt besuchten und ihm dabei ein bisschen Geld zusteckten.
Das alles (oder so Ähnliches) hatte Ruth verhindert.
Christopher war ein weltbekannter Professor heute. Er hatte keine Schäden aus der Kindheit davongetragen, und deshalb würde Ruth sich auch nicht schlecht fühlen. Sie hatte eine pragmatische Lösung im Sinne der Familie gewählt, niemand war verletzt worden.
Allenfalls Karolin hatte vielleicht ein bisschen etwas abbekommen, vielleicht war sie lesbisch geworden, weil sie über Jahre beobachtet hatte, wie ein Mann, ohne es zu wollen, das Leben ihrer Mutter wenn nicht zerstört, so doch verhindert hatte. Sie hätte Karolin nicht mitnehmen dürfen damals nach Hamburg, andererseits ist in jenen Monaten die einzige echte Bindung zu einem ihrer Kinder entstanden. Sie hatte nach der Rückkehr nicht den Eindruck gehabt, dass Karolin von dieser angeblichen Missbrauchsgeschichte mit dieser Sekretärin großen Schaden davongetragen hatte, wie alle befürchtet hatten, vor allem Martin und seine anstrengende Frau.
Martin hatte in den Wochen nach ihrer Rückkehr noch einige Male angerufen, um sich zu erkundigen, wie Karolins „Rekonvaleszenz“ – ganz klar ein Begriff aus dem Psychosprech seiner Frau – vonstattenginge, und Ruth hatte ihn jedes Mal abwimmeln müssen (unvorstellbar, die Zeit vor Rufnummererkennung und Mailbox, als Menschen mit freudiger Stimme fragend ihre Namen in den Hörer riefen und die Annahme von Telefongesprächen noch für wahre Überraschungen sorgen konnte). Sie sei auf dem Sprung gerade, sie riefe zurück, hatte Ruth über Martins „Ich will doch nur kurz …“ hinweggesagt, aufgelegt und nicht zurückgerufen. Nach ein paar weiteren Versuchen und sogar einem von Elenore hatte Martin endlich aufgegeben. Auf eine Art war er auf vergleichbare Weise naiv wie Hans-Harald: alles immer gut gemeint, nur schlecht durchdacht. Es war doch schon in Hamburg offensichtlich gewesen, dass sie unterschiedliche Ansätze verfolgten, wie mit dem Missbrauchsverdacht umzugehen sei; sie wollte sich zu keiner Hysterie drängen lassen, erst recht nicht von einer Anthroposophin wie Elenore, deren pädagogische Leitsätze sicherlich nicht auf rationalen, wissenschaftlichen Erkenntnissen fußten.
Die Wiedervereinigung mit Hans-Harald war einfacher gewesen, als sie vermutet hatte. Er gab sich sichtbar Mühe, nicht verärgert zu sein, sondern liebevoll und gelassen. Vielleicht hatte ihn die plötzliche Härte und Konsequenz ihrer Handlungen erschreckt und eine Art Demut in ihm ausgelöst. Insofern hatte es zunächst so ausgesehen, als wären die Folgen ihres Ausbruchsversuchs überschaubar geblieben. Doch ihre innere Verfassung war von bleierner Woche zu bleierner Woche immer schlechter geworden. Aus Erleichterung und Dankbarkeit, dass Hans-Harald sie nicht verstoßen hatte (was sie an seiner Stelle getan hätte), hatte sie am zweiten Tag nach ihrer Rückkehr auf sein Drängen mit ihm geschlafen. Sie hatte nicht geglaubt, dass sie noch einmal schwanger werden könnte.
Und während Hans-Harald sich freute und glaubte, das dritte Kind symbolisiere einen Neustart ihrer Beziehung, eine Adrenalininjektion für ihre Gefühle, wusste Ruth, dass dies der Untergang war.
Sie konnte vor ihrem inneren Auge kein Baby erkennen, bloß einen langen dunklen Tunnel aus fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn Jahren, bis das bisher noch ungeborene Kind selbstständig sein würde. Das wäre dann weit nach der Jahrtausendwende, sie wäre über fünfzig. Christopher wurde schon elf, Karolin acht, bald schon hätte sie halbtags arbeiten können; klar, die Professorenkarriere bei Martin war abgehakt, aber wenigstens Dozentin in Köln, ein Proseminar, ein- oder zweimal die Woche – was sie vor Kurzem noch empört abgelehnt hätte. Nun mit dem Fötus im Bauch würde sie alles dafür geben. Doch jetzt fühlte sie sich behindert, die Schwangerschaft kam ihr vor, als säße sie im Rollstuhl, sie empfand sich selbst als unmodern, eine Fünfzigerjahrefrau, die nicht aufpassen konnte und sich stumpf hatte schwängern lassen. Sie versuchte, sich an das Gefühl zu erinnern, das sie hatte, als sie mit Christopher und Karolin schwanger war, wie sie trotz des zusätzlichen Gewichts durch die Welt geschwebt war und sich alles richtig angefühlt hatte. Diesmal fühlte sich nichts mehr richtig an. Jeden Morgen und jeden Abend musste sie ihren Blutdruck messen, beobachtete mit bangen Augen das Ziffernblatt des Messgeräts. Ab 100 wurde sie nervös, allmählich müsste der Zeiger sich verlangsamen, ab 120 wurden ihre Hände feucht, jetzt muss er stoppen; wenn er über die 140 ging, würde eine zweite Messung nötig und dann eine halbe Stunde später eine dritte, dabei hoffen, dass der verdammte Zeiger wieder fiel; ab 160 musste sie ins Krankenhaus zur Beobachtung, und wenn der systolische Wert auch dort nicht zu senken war, würde eine Frühgeburt eingeleitet werden müssen.
Dann wäre es wenigstens vorbei. Präeklampsie hieß diese Krankheit, früher hatte man sie Schwangerschaftsvergiftung genannt, passend, fand Ruth, denn so fühlte sie sich, vergiftet.
Sie wollte dieses Kind nicht haben, denn es würde immer das Stigma ihres Scheiterns tragen. Der Sargnagel ihrer beruflichen Ambitionen. Sie würde es anschauen und denken, du stehst so tief in meiner Schuld, es gibt nichts, womit du das überhaupt gutmachen könntest. Das Kind konnte nichts dafür, sie wünschte, sie könnte es lieben wie Christopher und Karolin. Als Vater kam zum Glück eigentlich nur Hans-Harald infrage. Sie hatte mit Hans-Harald über einen Abbruch geredet, obwohl sie wusste, dass sie das nie tun würde. Aber sie wollte Hans-Harald Angst machen, damit er den Ernst ihrer Situation begriff.
Eltern würden ihr Leben geben für ihre Kinder, sagt man. Ja, natürlich, das wusste sie, das Gefühl kannte sie, und sie hoffte, dass sie es auch bei diesem Baby noch spüren könnte. Aber sie war schon seit mehr als elf Jahren Mutter, sie dachte, sie sei langsam auf dem Weg Richtung Ausfahrt, in zwei Jahren würde Karolin aufs Gymnasium gehen. Und jetzt zwang dieses Kind sie wieder in die Knie, zurück an den Anfang, alles von vorn, sie war eine Intellektuelle, Herrgott, nicht die Mutter der Nation.
Sie quälte Hans-Harald. Es war seine Schuld. Es konnte nicht die Schuld des armen Kindes sein. Nach der Geburt hatte Hans-Harald sie gefragt, wie der Junge heißen sollte. Es sei ihr egal, hatte Ruth gesagt. Hans-Harald solle einen möglichst lieblichen Namen aussuchen, vielleicht falle es ihr dann einfacher, das Kind zu mögen. Benjamin, hatte Hans-Harald gesagt, wir nennen ihn Benjamin, der kleine Sohn.
Sie konnte Benjamin nur schwerlich stillen, sofort nach der Geburt hatten sich ihre Brustwarzen entzündet. Das Kind hatte nicht nur ihre Lebensplanung zerstört, jetzt fügte es ihr noch körperliche Schmerzen zu. Sie wurde wütend, sie wollte das Kind schütteln, obwohl ihr wie allen Müttern im Krankenhaus gesagt wurde, Schütteln sei das Einzige, was eine Mutter mit einem Neugeborenen nicht tun durfte. Ich bin schon zweifache Mutter, hatte Ruth die Schwester angeraunzt. Jetzt bin ich dreifache! Aber danke für den Tipp.
Karolin wurde ihr verlängerter Arm. Sie delegierte so viele Aufgaben wie möglich an das achtjährige Kind, das seiner Ersatzmutterrolle gern nachkam.
Seit der Hamburg-Zeit war Karolin wie ausgewechselt. Sie war jetzt vorlaut und altklug. Wohlwollender formuliert könnte man sagen, sie war selbstbewusst. Ruth wusste nicht, ob das nun ein Zeichen der von Elenore und Martin heraufbeschworenen Traumatisierung war oder schlicht Ausdruck der gesunden Entwicklung eines jungen Menschen, der in einer Ausnahmesituation eine Art Selbstermächtigung erfahren hatte. Baby Benjamin nahm die Minimutter jedenfalls dankbar an, und Karolin genoss es sichtlich, ein hartes Regiment mit ihm zu führen. „Benjamin! Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst die Milch nicht auf deinen Strampelanzug spucken! Den muss ich dann wieder waschen“ (was nicht stimmte). Manchmal meinte Ruth eine sadistische Ader im Verhalten Karolins gegenüber dem Baby zu entdecken. Aber war das nicht normal für größere Geschwister oder doch Ausdruck dessen, was sie in Hamburg erlebt hatte?
Ein paar Monate nach der Geburt meldete sich Martin, um zu gratulieren. Sie hatte ihm eine Geburtsanzeige geschickt, wahrscheinlich damit er wusste, dass nun endgültig alles vorbei war. Mit ihrer akademischen Laufbahn, wie auch mit jedweder romantischen Erregung, die womöglich mal zwischen ihnen existiert hatte. Sie war gerade allein mit Benjamin, hielt ihm missmutig die Flasche hin, die das Baby aber inzwischen lieber von Karolin empfing. Es war ein grauer Vormittag in Köln. Die Kinder waren in der Schule, Hans-Harald im Dienst. Diesmal wimmelte sie Martin nicht ab.
Ihr war langweilig, nicht aus Beschäftigungsmangel, mit dem Baby gab es genügend zu tun, aber im Kopf. Es war genügend Zeit vergangen, mehr als ein Jahr, seit dem überstürzten Abschied in Hamburg. Sie freute sich, Martins ruhige, immer leicht ironisch gefärbte Stimme zu hören, ein Poststrukturalist der ersten Stunde mit großer Skepsis gegenüber allem Absoluten und Eigentlichen. Er fragte nicht mehr nach Karolin, wahrscheinlich hatte er es vergessen, und Elenore hatte längst das nächste vermeintliche Opfer ausgemacht, das ihrer Hilfe bedurfte, und war längst weitergezogen mit ihrem kleinen psychotherapeutischen Bauchladen. Mit der Karolin-Angelegenheit aus dem Weg und ohne den Druck, doch noch bei Martin reüssieren zu müssen, fühlte Ruth sich mit einem Mal wie befreit. Und hatte Lust, mit Martin zu sprechen, wollte die neusten Gerüchte, Skandale und Skandälchen aus der Universität hören, wer sich mit welchen Veröffentlichungen blamiert hatte und wann die alten Germanisten der Nachkriegszeit mit ihren metaphysischen Interpretationsmethoden endlich abträten. „Du hättest sie ablösen können, Ruth, vor dir haben sie gezittert, aber jetzt bleiben sie alle.“ Und darüber konnte Ruth sogar lachen.
Martin erzählte ihr unterhaltsames Zeugs aus der akademischen Welt, die ihr immer dröge vorgekommen war. Doch jetzt, mit dem nach seinem Fläschchen eingeschlafenem Kind in ihrem Arm, begann diese Welt in ihrer Vorstellung zu funkeln.
„Nun wo du dich nicht mehr bei mir habilitieren wirst, werden wir uns trotzdem noch einmal sehen – oder endet unser Weg hier?“
„Im Gegenteil“, sagte Ruth und fühlte sich zum ersten Mal seit Hamburg wieder beschwingt, „jetzt wo wir die beruflichen Abhängigkeiten aus dem Weg geschafft haben, kann unsere Freundschaft doch richtig beginnen.“
„Du meinst, das hat sie noch nicht?“
„Wie heißt es bei Thomas Mann? ›Das Glück kommt zu denen, die es erwarten. Nur müssen sie die Türen auch offen halten‹.“
„Wir haben sie offen gehalten“, sagte Martin.
Ein Fenster in die Welt hatte sich geöffnet. Plötzlich schien das Leben wieder erträglicher. Da war eine Existenz jenseits der drei Kinder und der merkwürdigen Parallelexistenz, die sie mit ihrem Mann aufrechterhielt. Sie erzählte Martin von der fürchterlichen Schwangerschaft, ihrer Unzufriedenheit mit der Mutterschaft, ja dem Unglück ihres Lebens. Sie tat dies zum ersten Mal überhaupt. Sie brach kurzfristig mit den Grundsätzen, die ihr Vater ihr als Kind beigebracht hatte und an denen sie auch als erwachsene Frau noch festhielt: Never complain, never explain. Sich niemals beklagen, sich niemals erklären.
Sie erinnerte sich, wie ihr Vater ihr diesen Leitsatz das erste Mal erklärt hatte. Sie musste zwölf gewesen sein oder dreizehn. Er war von einer Dienstreise zurückgekommen, „von den Amerikanern“, wie er mit stolzem Timbre sagte. Das Pentagon wollte damals, Ende der Fünfzigerjahre, die Bundeswehr im Rahmen der NATO mit den Vorläufern der Pershing-Raketen ausstatten, und Rupert Wartenburg, der sich nach dem Krieg mithilfe des in Westdeutschland stationierten US-Militärs Englisch selbst beigebracht hatte, war Teil einer deutschen Delegation gewesen. Sie sollten sich im Pentagon und an anderen Militärstützpunkten innerhalb der USA um Vorbereitung und Logistik der Lieferungen kümmern. Es war eine lange Reise gewesen, und Ruth hatte ihren Vater vermisst. Die frühabendlichen Schachpartien, die Algebra-Hausaufgaben, die ihr Vater, der Mathematik studiert hatte, in seiner Mittagspause, in der er oft zu einem Essen und kurzem Schlaf nach Hause kam, absichtlich, aber anspruchsvoll falsch löste. Manchmal brauchte Ruth Stunden, um den Fehler, den ihr Vater in die Gleichung eingebaut hatte, zu finden. Die Hausaufgaben zogen sich so über halbe Nachmittage, doch wenn Rupert Wartenburg abends wieder nach Hause kam, präsentierte Ruth ihrem Vater mit leiser Freude seinen Fehler. Das alles fiel aus, wenn er auf einer seiner vielen Reisen war.
Als er an einem Sonntagmorgen endlich zurückkam und seine Tochter ihm erklärte, es sei ganz doof gewesen ohne ihn, nahm sein Gesicht strenge Züge an. Die Mathematikrätsel hätten ihr gefehlt, hatte Ruth geklagt. Ohne sie seien die Hausaufgaben langweilig, und sie habe deswegen nicht alle erledigt. Er müsse verstehen, ohne ihn sei das nichts. Es sollte nett gemeint sein, sie hatte ihn vermisst. Doch sie hatte es wohl mit ihren Klagen über seine Abwesenheit übertrieben und war erschrocken über das, was er dann sagte: „Ruth, hör auf dich zu beklagen! Ich muss das alles nicht wissen. Und erkläre mir nicht, warum du nicht geschafft hast, was du zu erledigen hattest. Ich musste weg. Punkt. Erkläre mir nicht, was das für dich bedeutet. Es interessiert nicht. Ich sage dir etwas, merke es dir für dein Leben. Die Engländer haben einen guten Leitsatz: Never complain. Never explain. Weißt du, was das bedeutet?“
Ruth, die bisher erst Latein lernte, schüttelte den Kopf.
„Es heißt: Beklage dich niemals, und erkläre niemals dein Verhalten. Zwei simple Regeln, mit denen du, wenn du sie befolgst, weit durchs Leben kommen wirst.“
„Kommen sie aus Amerika? Hast du sie von dort mitgebracht?“
„Nein, sie kommen aus England. Ich kenne sie schon lange. Ungefähr, seit ich in deinem Alter war. Ich kenne sie von meinem Vater. Wir wollen uns an sie halten.“
An diesem Tag hatte Ruth sich zum letzten Mal beklagt. Und sie hörte an diesem Tag auch auf, ihr Verhalten zu erklären, ihre Fehler zu erläutern. Hans-Harald hatte immer wieder im Laufe der Ehe – erstmals in den Flitterwochen am Strand von Sorrent, später als sie mit Christopher schwanger war und zuletzt gar nicht lange, bevor sie nach Hamburg floh – versucht, das Innenleben seiner Ehefrau zu ergründen. Nein, sie hatte sich nie beklagt. Trotzdem, oder deswegen, hatte man ihr natürlich angemerkt, wenn es ihr nicht gut ging. Kein einziges Mal hatte Hans-Harald eine ernst zu nehmende Erklärung zu ihrem seelischen Zustand gehört. Lässt sich all das auf die zwei Sätze Rupert Wartenburgs zurückführen, viele Jahrzehnte zuvor, als der große Weltkrieg noch keine fünfzehn Jahre vorüber war? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch.
Sie sprach mit Martin am Telefon anderthalb Stunden lang. Erst vorsichtig, schließlich immer vehementer beklagte sie sich. Es fühlte sich gut an, sich zu beklagen. Ein einziges Mal, sagte sie sich. Ein einziges Mal würde sie lockerlassen dürfen, gegenüber diesem Mann, den sie so lange kannte, dem sie sich so verbunden fühlte und der doch, zum Glück, so weit weg war. Martin hörte zu, manchmal stellte er eine gezielte Frage, brummte durch die Leitung, hörte wieder zu und brummte noch mal. Und Ruth erklärte sich. Warum sie nicht in Hamburg hatte bleiben können; warum sie Hans-Harald nichts gesagt hatte; dass sie glaubte, nur in Hamburg bei ihm, Martin, arbeiten zu können, und erzählte von ihren Problemen mit dem Baby Benjamin, deren Dringlichkeit Martin als meist abwesender Vater zweier Teenager-Töchter nicht verstand.
Martin war kein Pragmatiker wie Hans-Harald. Er war ein von Derrida bis Luhmann und Lacan geschulter Denker, der es gewohnt war, die zunächst vermeintlich augenfällige Lösung infrage zu stellen. Sein Denken war nicht der Praxis verpflichtet, sondern der Originalität. Mit Martin zu sprechen fühlte sich an, als wäre ihr Kopf in Urlaub gefahren und würde nun durch neue Landschaften ziehen, unbekannte Felder und Wiesen, in denen es sich atmen ließ. Urlaub von ihrem Gewissen. Niemand, der wegen ihrer vernachlässigten Mutterschaft über sie richtete; keiner, der auf durchgelatschten Moralpfaden daherlief. Wenn sie nur noch Martin zuhören würde, wäre das Leben wieder erträglich. Er war noch komplizierter als sie. Er war, da war sie sich sicher, ein grauenvoller Ehemann, als Ehepartner bestimmt noch schlechter als sie. Das zog sie zu ihm hin. In seiner Gegenwart musste sie sich nicht schlecht fühlen. Sie hatte das Licht gesehen. Als Baby Benjamin aus seinem Babyschlaf hochschreckte, wachte auch sie auf, zurück in dem Unglück, das ihr Leben war.
Der Kongress der Internationalen Germanistenvereinigung fand 1987 in Göttingen statt. Martin rief an (wie immer am Spätvormittag, wenn er davon ausgehen konnte, dass Ruth mit Baby Benjamin allein war) und sagte, er sei der Hauptredner am ersten Abend. Er wisse, das Kapitel Literaturwissenschaft sei für Ruth endgültig abgeschlossen, aber mal für drei Tage raus aus der Babyhölle (das sagte er wörtlich so), sei doch vielleicht nicht schlecht, sie wisse doch, das akademische Leben könne man besonders dann genießen, wenn man selbst nicht mehr mittendrin stecke, und Göttingen sei doch keine drei Stunden von Köln. Er könne sie anmelden als außerfakultätischen Gast.
Hans-Harald war begeistert von der Idee, dass Ruth sich zweieinhalb Tage für sich nehmen wollte. Er würde am Freitag schon am frühen Nachmittag aus der Behörde kommen, dann könne sie sofort los und noch zur Abendveranstaltung in Göttingen sein, Sonntagabend dann zurück. Er schien geradezu erlöst von der Aussicht, nach diesem Wochenende eine vielleicht etwas weniger missmutige Frau wiederzubekommen. Ruth hatte inzwischen zu Hause die Sichtweise zementiert, dass Hans-Harald ein wunderbares Leben führen durfte, mit seiner Arbeit, seinem Erfolg, seiner Beliebtheit bei den Kindern, es aber selbstverständlich nicht seine Schuld war, dass es ihm so gut ging. Natürlich hätte er seinen beruflichen Erfolg nicht gefährden können, nur damit sich seine Frau besser fühlte. Er zerschlug schließlich bundesweit operierende Betrugsringe, während sie nur Streulicht auf die Frage warf, inwiefern die frühen Texte von Thomas Mann von seiner Sexualität informiert waren – wer war sie, da Ansprüche zu stellen, formulierte sie süffisant gegenüber Hans-Harald und beobachtete, wie das Hirn ihres Staatsanwaltsgatten zu ermitteln versuchte, ob diese Aussagen als glaubwürdig oder sarkastisch einzuordnen waren.
Er bemühte sich, früher nach Hause zu kommen, obwohl er vorher mit 17:00 Uhr schon zu einer Zeit gekommen war, von der andere in vergleichbaren Positionen nur träumen konnten. Er begann, einen Tag in der Woche ganz zu Hause zu bleiben, was die Sache aber nicht besser machte, weil es ihm, der sonst zufrieden seiner Berufung nachging, nur noch mehr ermöglichte, ehrlich gut gelaunt den Supervater zu geben. Wenn Hans-Harald, nunmehr oft gegen 15:30 Uhr, in der Tür stand, ließ sie ihn beinahe immer sofort Zeuge eines sich entfaltenden Dramas werden. Wenn nicht ohnehin schon eins im Gange war, konnte es passieren, dass Ruth, vielleicht nicht absichtlich, aber doch unbewusst, eins entzündete, damit er sehen konnte, was hier los war den ganzen Tag. Ihr rutschte dann versehentlich Benjamins Flasche aus der Hand, sodass das bekleckerte Baby zu schreien begann, oder sie tat sich selbst weh, verhob sich am Babystuhl, verbrannte sich am heißen Wasser für die Flasche; oder sie ermahnte Karolin lautstark, sich endlich Hausschuhe anzuziehen oder Christopher, die Toilette ordentlich zu hinterlassen. Ruth wusste, dass Hans-Harald in solchen Situationen nicht besonders stressresistent war, und so gelang es ihr oft, den Nervenzustand ihres Mannes innerhalb weniger Minuten auf ihr Niveau runterzuziehen.
Schon Wochen vor dem Germanistentag freute sie sich. Nach allem, was in Hamburg schon vorgefallen war, wusste sie, es war gefährlich, gleichzeitig fragte sie sich, was schon passieren könnte. Verschlimmern konnte sich ihr Zustand nicht. Sie wollte sich nicht beklagen, klar, aber mit niemandem sprechen zu können, forderte doch seinen Tribut. Mit Martin würde sie reden können, vorsichtig natürlich, sie durfte ihn nicht langweilen mit ihrem häuslichen Lamento, es musste interessant und dramatisch sein. Am besten würde sie es in einen gesellschaftspolitischen Zusammenhang betten, damit es Martin interessierte: Sie würde es mit einer Kritik an der zu naiven zweiten Welle des Feminismus verknüpfen, hatte sie sich überlegt, jenem Siebzigerjahre-Feminismus der wuchernden Schamhaare und weggeschmissenen BHs, den Martin wegen Elenore (die natürlich eine große Verfechterin war) und einiger nerviger Doktorandinnen ebenfalls ablehnte. Aber sie würde, welche Heilung sie auch immer von Martin bekommen könnte, nichts umsonst erhalten. Sie hoffte (zumindest sagte sie sich, dass sie das hoffte), dass der Preis nur in geistreicher intellektueller Begleitung bestand, war jedoch, wie gesagt, nach den Vorkommnissen in Hamburg nicht mehr so sicher. Doch wenn sie ihr Leben retten wollte, hatte sie keine Wahl.
Göttingen wurde ein voller Erfolg, wenn man so wollte. Von der Eröffnungsrede durch Richard von Weizsäcker (seit Theodor Heuß hatte kein amtierender Bundespräsident mehr auf dem Germanistenkongress gesprochen) über die Wahl eines Japaners (sic) als neuen Vorsitzenden der Internationalen Germanistikvereinigung (Martin hatte erklärt, warum das taktisch klug sei, doch sie hatte nicht zugehört, bei aller Liebe) bis hin zu „ihrem Italiener“, den sie am ersten Abend gefunden hatten, als sie sich, wie zwei Schüler, während der Weizsäcker-Rede nach der Hälfte fortgestohlen hatten (Ruth hatte sich selbst nicht erkannt, hätte Hans-Harald so etwas vorgeschlagen, hätte sie es als kindisch abgelehnt) und in der Nähe der Stadthalle in einer Einkaufspassage in der Pizzeria Valtellina Zuflucht gefunden hatten, fernab vom Trubel und den prätentiös daherredenden Kollegen. Sie hatten dieses Ritual dann jeden der drei Abende wiederholt, es waren ihre drei Stunden (abgesehen von denen im Hotel), in denen Ruth über ihr Leid hätte sprechen können, aber es doch nicht tat, weil sie es in den Momenten mit Martin nicht spüren konnte.
Wenn sie das, wusste Ruth nun, einmal im Monat vielleicht haben könnte, drei Tage eines Parallellebens, einer alternate history, drei Tage nur, Tage wie diese, es wären nur ein paar vom Schicksal (oder Martin) hingeworfene Körner. Doch sie würden womöglich fürs Erste reichen, sie nicht sterben zu lassen an Lebensskorbut.
Doch warum sollte Martin das tun, er war verheiratet mit einer herausfordernden, aber sicherlich interessanten Frau, hatte zwei Kinder an der Schwelle zum Erwachsenwerden, war einer der wichtigsten deutschen Literaturwissenschaftler und hatte als solcher längst sicherlich neue Ruths aufgetan, hübsche vielversprechende Doktorandinnen und/oder junge brillante Frauen, die sich bei ihm habilitierten. Für ihn waren die Kongresstage in Göttingen ein gut gemeintes, partiell aus Mitleid hingeworfenes Abschiedsgeschenk für seine einst wichtigste Mitarbeiterin. Ein würdiger Abschluss, denn Martin hatte immer Stil gehabt.
Zu ihrer Verblüffung rief er gleich in der übernächsten Woche wieder an, wie immer zur gleichen Zeit am Mittag, wenn er glaubte, dass Baby Benjamin schlief und Ruth Zeit hatte. Er sagte, er würde gern mit ihr noch einmal zum Kongress der Internationalen Germanistenvereinigung fahren (Ruth schöpfte Hoffnung), doch leider, leider (Ruths Mut sank, aber er hatte ja recht), leider fände der Kongress der Internationale Germanistenvereinigung nur alle fünf Jahre statt. Aber er habe seine studentische Hilfskraft mal andere, kleinere Tagungen der kommenden Monate raussuchen lassen, manche an gar nicht so unreizvollen Orten: Literatur und Psychoanalyse in Freiburg, Alfred Döblins Poetik des Wissens im Kontext der Moderne in Bielefeld, Zur Literatur und Literaturwissenschaft der DDR in Ostberlin, Deutsche Literatur nach zwei Weltkriegen in München, unter anderem.
Und wenn das nicht genug sei, um ihren Hunger nach Fortbildung (und Zusammensein) zu stillen, dann würden sie auf die Teilgebiete ausweichen, sagte Martin, Linguistik, die Ruth mit ihrem mathematischen Gehirn sicherlich liegen würde, ihn jedoch langweilte; Logik, wo die Kollegen der Philosophie Literaturwissenschaft spielten und die großen poststrukturalistischen Schlachten geschlagen wurden, und zur Not, wenn der Ort stimmte, könnte sie auch mal bei den Mediävisten vorbeischauen. Jenseits dieser wissenschaftlichen Treffen von maximal drei Tagen am Stück würden sie sich nicht sehen. Dann würde diese Angelegenheit, wie Martin sagte, auch niemals außer Kontrolle geraten.
Und daran hielten sie sich für die nächsten dreizehn Jahre, nur manchmal kam, wenn die Abstände zu lang wurden, ein Brief hinzu. Martin ließ sie mit gedruckten Adressaufklebern in den Umschlägen der Universität aussehen wie offizielle Post; sie schrieb ihm ans Institut. In Hans-Haralds Augen hatte seine Frau beruflich zwar zurückgesteckt, besuchte jedoch regelmäßig Kongresse und Tagungen, wo sie mit Kolleginnen in Kontakt blieb und selber manchmal einen Vortrag hielt (das hatte Ruth nie behauptet, allenfalls suggeriert, wenn sie sich an den Abenden vor einer Tagung an ihren Schreibtisch zurückzog und sich „einlas“). Sie hatte Hans-Harald in all den Jahren nie aktiv belogen, das war ihr wichtig. Das hätte sie auch nicht geschafft, bildete sie sich ein, denn sie war keine Lügnerin. Sie hatte Dinge weggelassen, das ja. Doch das war etwas fundamental anderes. Informationsmanagement war ihrer Ansicht nach Teil einer vernunftbegabten Zivilisation. Wenn jeder Mensch alles, was er dachte, alles, was er erlebte, mit jenen teilte, die ihm oder ihr am wichtigsten waren (und das waren Hans-Harald, Christopher, Karolin und Benjamin), wären Schmerz und Leid allerorten. Ständig wäre man nicht nachvollziehbaren oder verletzenden Aktionen anderer ausgesetzt, und umgekehrt. Nicht alle der eigenen Handlungen waren anderen erklärbar. Dafür war der Mensch in all seinen externen Verstrickungen zu komplex.
Sie hatte nie erfahren, ob die Verbindung auch zu Martins Leben etwas Unverzichtbares hinzufügte oder ihm nur zur Unterhaltung und Zerstreuung diente. Es spielte jedoch auch keine Rolle für sie. Ruth hatte die Verbindung über mindestens zehn andernfalls gefühlt tödliche Jahre hinweggeholfen. Als Mitte der Neunzigerjahre zuerst Christopher, dann Karolin auszogen und nur noch Benni blieb, löste sich der Druck. Sie war stolz auf ihre beiden inzwischen erwachsenen Kinder, stolzer vielleicht als auf alle akademischen Meriten, die sie hätte verdienen können. Schon ein paar Jahre zuvor hatte sie, nach viel gutem Zureden von Hans-Harald und gegen, interessanterweise, starken Widerstand von Martin („Entweder ganz oder gar nicht, Ruth, aber dafür bist du zu gut“) eine Teilzeitstelle als Privatdozentin an der Universität Koblenz angenommen. Martin hatte recht, es war nicht gerade Cambridge, aber der pädagogische Wert, die Arbeit mit (noch) motivierten Erst- und Zweitsemesterstudenten, die Möglichkeit, ihnen ein Instrumentarium zu vermitteln, mit denen Texte besser zu verstehen waren, bereiteten ihr, wenn sie ehrlich war, mehr Freude als die hochabstrakten Operationen, fernab von jedem Leser, die Martin immer noch vollführte.
Benni hatte sich entgegen allen Vorzeichen zu einem freundlichen und offenbar auch hochintelligenten Jungen entwickelt und schien sich an Ruths einstige Ablehnung nicht zu erinnern. Bis heute ist er der einzige Mensch, den sie mit Kosenamen ruft. Sie hatte Hans-Harald das Harry verwehrt und Christopher das Chris (früher hatte er sich darüber manchmal beschwert, doch das verstand er nicht). Ruth war so erleichtert, schrieb es aber auch ihrer Disziplin zu, dass Hans-Harald nie etwas von den Wochenenden mit Martin gemerkt hatte. Bei aller Vorsicht hatte all die Jahre natürlich immer die Gefahr der Aufdeckung über ihr geschwebt, ein blöder Zufall hätte doch gereicht, und eigentlich kommen ab einer bestimmten Dauer solche Dinge immer heraus. Sie wusste, dass sie sich mit ihrer komplizierten Konstruktion, wonach Verschweigen kein Lügen und damit kein Betrug sei, in der Außenwelt (sprich gegenüber ihren Familienmitgliedern) vermutlich schwergetan hätte. Dass es nicht doch herausgekommen war, führte Ruth auf Hans-Haralds Urvertrauen zurück. Ein weniger selbstbewusster, in sich ruhender Mann hätte vielleicht doch mal gefragt, mit wem sie denn auf all diesen Kongressen so zusammenkäme. Dass Hans-Harald das nicht getan hatte, erfüllte sie nicht nur mit Dankbarkeit, sondern regelrecht mit Bewunderung. Ruth war kein Mensch, der sich Bewunderung anmerken ließ, normalerweise bewunderte sie schlicht auch niemanden. Aber auch Hans-Harald schien zu bemerken, dass die zehn Jahre finsterster Düsternis vorbei waren; dass seine Frau nicht nur zugewandter und fröhlicher war, sondern ihn sogar gut zu finden schien, ein Gefühl, das er völlig vergessen hatte. Manchmal hatte sie sogar Lust, mit ihm ins Kino zu gehen oder in eine Weinstube. Unausgesprochen schienen beide Ehepartner das Gefühl zu teilen, es geschafft zu haben. Ruth wusste warum; Hans-Harald mochte seine Theorien dazu haben, aber sie waren falsch, weil ihm, wie gesagt, ein paar Informationen fehlten.
Der neuerliche eheliche Aufschwung bestätigte Ruth natürlich in ihrem Handeln. Sie war klüger als andere, sie dachte das nicht explizit, aber das Gefühl war da. Ihrer umsichtigen, ja schon realpolitischen Strategie mit Martin war es zu verdanken, dass die Familie noch bestand und Hans-Harald und sie nun noch zwanzig, dreißig schöne Jahre mit den Kindern vor sich hatten sowie mit deren irgendwann zu gründenden eigenen Familien, den Schwiegertöchtern und dem Schwiegersohn samt zahlreicher Enkelkinder.
Aber da war noch etwas, das Ruth Ende der Neunzigerjahre bewogen hatte, die Treffen mit Martin besser auslaufen zu lassen. Martin hatte Elenore verlassen. Eigentlich hätte sie dem vorherigen Satz ein „endlich“ hinzugefügt, doch durch die Trennung war Martin zu einer loose cannon geworden, völlig unberechenbar. Seit er wieder dauerhaft in seiner Junggesellenwohnung am Rotherbaum wohnte, jener grauenvollen Bude, in der sie seinerzeit die unglücklichen Wochen mit Karolin verbracht hatte, kam es ihr so vor, als würde er häufigere, längere und gewagtere Treffen vorschlagen. Die Tektonik ihres Arrangements drohte dadurch ins Wanken zu geraten, und Ruth wusste, dass damit die Sache tot war. Wenn eine Seite unberechenbar wurde, ging es nicht mehr.
Sie konnte mit Martin nicht Schluss machen, wenn man das überhaupt so nennen konnte. Sie mussten im Guten auseinandergehen, nur, wie sollte das funktionieren, nach all den Jahren? Ruth stellte fest, dass eine Affäre zu haben deutlich einfacher war, als sie nicht mehr zu haben. Sie musste Martin verhungern lassen, ohne dass er es so richtig merkte, bis der Preis für seinen Stolz zu hoch sein würde. Nicht schön aus heutiger Sicht, aber damals musste es so sein.
Und Martin hatte begriffen, ohne dass ein weiteres Wort gewechselt wurde, seine Anrufe wurden seltener, die Briefe blieben irgendwann aus.
Ruth hätte es nicht mehr für möglich gehalten, dass sie viele Jahre später in Straßenkleidung auf einem Peloton-Rad in einem fensterlosen Fitnessraum sitzen würde, und irgendwas doch noch grandios schiefgegangen war.
Wir waren im Museum Dia Beacon mit einer Gruppe von Leuten, meine Frau und ich, meine Eltern, die Schwester meiner Frau und einige andere, entferntere Verwandte. Es war der Tag vor unserer Hochzeit, Herbst 2015, wir lebten damals in New York, strahlende Sonne, ein Indian-Summer-Tag, wie es ihn nur an der Ostküste der USA gibt. Im Dia Beacon sind riesige Installationen zu sehen, Skulpturen, Konzeptkunst und auch ein paar Gemälde, Werke von 1960 bis heute, Arbeiten von Richard Serra, Dan Flavin, On Kawara, Blinky Palermo oder Andy Warhol. Das Museum liegt knapp zwei Stunden nördlich von New York City, an den Uferwiesen des Hudson River in minimalistich renovierten Industriehallen, in deren großen Fensterscheiben sich das Herbstlicht bricht. Der Hudson, auf den man von einer kleinen Anhöhe herunterblickt, ist hier besonders breit und der Himmel besonders hoch. Das Publikum, Fans von Installations- und Konzeptkunst, kommt aus New York, Los Angeles oder Tokio hier aufs Land gereist, es trägt schwarze Rollkragenpullover und überdimensionale Brillen, es liegt Distinguiertheit und Kennerschaft in der Luft. Für viele einer der schönsten Orte Amerikas.
Für mich nicht mehr.
Während der letzten zehn Minuten unserer Fahrt ins Dia Beacon begann im Auto ein kleiner Disput, er begann mit eigentlich banalen Logistikfragen der kurzfristig anberaumten Hochzeitsfeier und ihrer Gästeliste. Doch schon auf dem Museumsparkplatz hatte er sich zu einem handfesten Streit entwickelt, meine Frau und ich bildeten eine Einheit, aber ansonsten ging es alle gegen alle in wechselnden Koalitionen, und plötzlich wurden nicht mehr Logistik-, sondern Grundsatzfragen verhandelt.
Es musste für jeden Unbeteiligten ein herrliches Bild abgegeben haben (wäre es nicht so traurig gewesen), und bis heute frage ich mich, ob zufällig die Drehbuchautoren von White Lotus oder Succession zugeguckt haben: eine Gruppe wohlsituierter Deutscher im Alter von Mitte zwanzig und Mitte siebzig stehen in dem wunderschönen Garten von Robert Irwin oder den phosphoreszierenden Lichtinstallationen von Dan Flavin – und schreien und weinen auf Deutsch.
So schlimm, dass meine Frau und ich alle wieder ausladen und allein im Marriage Office der City Hall heiraten wollten. Schließlich konnte das Fest dann haarscharf doch noch stattfinden, und in den Jahren danach wurde noch viel über „die schöne Hochzeit“, aber nie wieder über den Tag davor geredet.
Trotzdem musste es für diese Eruption offenbar tief vergrabene Vorwürfe, Schuldzuweisungen und Unterstellungen, ja Gründe gegeben haben, vergiftete unterirdische Lavaströme, die schon ihre Risse durch den festen Familiengrund gezogen hatten.
Damals begann ich, grundsätzlich über Familien und ihre Strukturen nachzudenken, ausgestattet mit allem, was ich bei John Updike, Philip Roth, Richard Ford oder später Jonathan Franzen oder Celeste Ng gelesen hatte. Die Literatur der Amerikaner und Amerikanerinnen schien seit mehr als einem halben Jahrhundert das Konstrukt Familie zu erforschen und zu hinterfragen, die Deutschen hatten zwar Thomas Mann und von ihm vor 122 Jahren Die Buddenbrooks, aber seither gab es das Genre des Großen Familienromans eigentlich nicht mehr (wenn man von einigen speziellen Ausprägungen wie Tellkamps Der Turm absieht).
Große Teile von Schönwald habe ich in den USA geschrieben, und wenn die Leute mich dort fragten, woran ich da schriebe, sagte ich an einer family novel und wunderte mich über die zurückhaltenden Reaktionen, bis mir jemand erklärte, dass es die family novel im Sinne von Familienroman auf Englisch nicht gebe, und eine famly novel schlicht ein Roman für die ganze Familie sei, wie ein family movie.
Mit dem Instrumentarium des amerikanischen Romans einer deutschen Familie zu Leibe rücken – und zwar ausdrücklich, um ganz frei sein zu können, nicht meiner eigenen – war die Idee. Ich wollte all die Hoffnungen, Erwartungen, Enttäuschungen und Vertuschungen anhand einer Familie betrachten, fragte mich beispielsweise, was es für die Mutter der Familie bedeutet haben könnte, mit verpassten Möglichkeiten und einem gescheiterten Ausbruchsversuch zu leben, welche Verwüstungen das angerichtet haben könnte, in ihr selbst, aber auch in ihren Kindern – und wie sie immer wieder auftraten als unterdrückte Konflikte, nicht verheilte Verletzungen, verschwiegene Fehltritte.
Einen Anstoß zu diesem Buch gab, als ich wieder nach Deutschland kam, die Debatte um die Eröffnung einer queeren Buchhandlung in Berlin. Der Laden war ein idealistisches progressives, heute würde man sagen: wokes – Projekt, angeboten wurden ausschließlich Bücher von queeren oder weiblichen Autorinnen. Die Gründerin war stolz und gab Interviews, in denen sie sagte, sie habe sich diesen Traum verwirklichen können durch die Erbschaft ihres Großvaters, der General bei der Bundeswehr war wie meiner. Als junger Mann war er allerdings, ebenfalls wie mein Großvater, in der Wehrmacht gewesen, und auf Instagram unterstellten bald junge, nicht weiße Blogger, dass sowohl Großvater wie auch Urgroßvater Stützen des Dritten Reichs gewesen seien. Das Kapital für den Buchladen sei deswegen schmutziges Geld. Die Buchladenbesitzerin, in der Sprache der Blogger eine „Deutsche mit Nazihintergrund“, war völlig überrascht von dem Vorwurf, für sie waren die Vergangenheitsverhältnisse ihrer Familie geklärt, wie für mich auch. Das Land, in dem wir lebten, hatte sich doch erst 1967 konstituiert, als ein ehemaliger Nazi, westdeutscher Polizist und Stasiagent in Personalunion, mit seinen Schüssen auf einen Berliner Studenten gleichzeitig auch dem alten Deutschland endgültig den Garaus machte; daraus und aus 1989, als die Menschen auf der Mauer tanzten, und vielleicht 2006, als sie sich Deutschlandfähnchen aus ihren Autos wehen ließen, ergab sich etwas, mit dem auch meine und ihre Generation etwas anfangen konnte.
In „Schönwald“ muss sich die Tochter ähnlichen Anschuldigungen stellen und beginnt deswegen, in der Vergangenheit zu graben, was bei Familien selten eine gute Idee ist, beziehungsweise natürlich gerade eine gute Idee, je nachdem, wie tapfer man ist.
Denn dann gerät man leicht in das Zentrum der Familie, wo all die Dynamiken entstehen, die dann über Generation hinweg wirken. Man entdeckt dort möglicherweise die eigenen nicht verwirklichten Wünsche, nicht gemachte Karrieren trotz großen Talents, die faulen Kompromisse; die abweichenden Lebensentwürfe der Kinder, die später in den Siebzigern nicht nur zu einer anderen Zeit, sondern gewissermaßen auch in einem anderen Land geboren wurden als ihre Eltern.
Mich interessierten die Erzählungen und Normalisierungen, die jede Familie für sich pflegt. Vielleicht waren sie irgendwann mal nötig, um überhaupt weitermachen zu können. Vielleicht sind aber auch sie es, die Traumata und Verhaltensweisen über die Generationen hinweg weitertragen. Können wir uns von ihnen freimachen und wenn ja, zu welchen Preis kommt diese Freiheit?
Irgendwann wurde mir klar, dass die Mutter in meiner Familie eine entscheidende Rolle spielen musste. Ich fragte mich, wie es ihr, ihrem Mann, den Kindern heute gehen würde, wenn sie selbst 1985 anders gehandelt hätte? Lag es an der Zeit, in die sie hineingeborgen wurde, oder an ihr selbst (oder ihrem eigenen Vater), welche Entscheidung sie getroffen hat?
War ihr Lebensweg, wie der so vieler Frauen ihrer Generation, den Müttern der Boomer-Generation, vorgezeichnet – und konnte sie sich dem entgegenstemmen?
Auch wenn alle Figuren fiktiv sind, musste ich natürlich über ein Milieu schreiben, dessen Typologien, Gefühle, Sprache und Orte ich kannte. Die Familie Schönwald kommt ursprünglich aus Bonn, wie ich selbst auch, und der älteste Sohn wohnt in New York, wo ich ebenfalls gelebt habe, er ist junger Poststrukturalismus-Professor an einer Universität, an der auch ich studiert (es aber nicht zum Professor gebracht) habe. Er sieht sich nicht in der Lage, seinen Eltern zu erzählen, dass die Universität ihm im Zuge eines MeToo-Skandals gekündigt hat. Sein Vater war so stolz auf ihn gewesen. Seine Kränkung und Scham treiben ihn zu den anderen Wütenden und Verletzten, zur amerikanischen Rechten, wo er als Verstellungskünstler zu seiner Überraschung reüssieren kann – in eine Szene, von deren Protagonisten ich einige in New York kennengelernt habe und die ich immer mal ausführlich beschreiben wollte.
In diesem Moment und auf einem Familientreffen in Deutschland, zur Buchladeneröffnung der Tochter, werden Jahrzehnte alte Dichtungen porös, jedes der drei Kinder der Schönwalds ringt mit Problemen, von denen ihre Eltern nichts ahnen. Alle drei ringen sie mit sich selbst, mit der Wahrheit, auch über sich selbst, und der Frage, wie sehr sie ihr Familienkonstrukt belasten können, ohne dass es kollabiert.
„Er seziert die Familie brillant als zeitgenössisches System verdrängter Konflikte und verwackelter Wünsche.“
„Das Besondere an diesem Buch ist, dass es komplett im Hier und Heute angesiedelt ist und aktuelle Themen literarisch verarbeitet – von der Alt-Right-Bewegung in den USA bis zur Wokeness in Deutschland. Alles nicht belehrend, sondern sehr gut lesbar und unterhaltsam.“
„Was für eine Familie! Was für ein Buch! Philipp Oehmkes Roman-Erstling gebührt ein Tusch.“
„Sehr interessante Beobachtungen, ein sehr rasanter Roman. Diese Charaktere, die sind wirklich schön Rund, es macht Spaß das zu lesen.“
„Der Autor, ein exzellenter Beobachter und geschickter Erzähler, hält nicht nur dieser Familie, sondern auch einer verlogenen Gesellschaft den Spiegel vor.“
„Ein großer Familienroman. Es wird klar, wie sensibel familiäres Gleichgewicht mitunter sein kann.“
„Ein gelungenes Beispiel für einen kritischen Blick in die bundesrepublikanische Vergangenheit, in der viel Geredet, aber wenig miteinander gesprochen wurde.“
„Oehmkes Schreibstil ist schnell und sehr unterhaltsam. Er ist ein wunderbarer Beobachter. Das Buch ist phasenweise deshalb sehr komisch, manchmal traurig. Immer fesselnd.“
„Oehmke hat ein gutes dramaturgisches Gespür, seine Sprache ist klar und strukturiert, manche Dialoge könnten aus einer Beziehungskomödie Woody Allens stammen.“
„›Schönwald‹ ist ein entlarvender, preisverdächtiger Roman, vielleicht sogar ein Buch des Jahres.“
„Philipp Oehmke liefert mit seinem Debüt den aktuellen deutschen Gesellschaftsroman.“
„Philipp Oehmke trifft einen Zeitgeist.“
„Philipp Oehmke hat sich an ein großes Familienepos gewagt – mit Erfolg.“
„Ein fulminanter, zeitgemäßer deutscher Familienroman, der an Jonathan Franzen erinnert und leider mit 544 Seiten immer noch viel zu kurz ist. Ein kurzweiliges Lesevergnügen, das uns den Spiegel vorhält.“
„Wie das Schweigen scheitert und die familiären Wahrheiten zu Tage treten, davon erzählt Philipp Oehmke in rasanter, komischer und treffsicherer Weise.“
„Oehmke beschreibt das dynamische und doch sehr wirbelnde Zusammenleben der beiden Generationen mit einer bildlichen und sehr treffsicheren Schreibfeder.“
„Unterhaltsam und tiefgründig beschreibt Philipp Oehmke Generationen, die nie gelernt haben, miteinander zu reden.“
„Ein sehr gegenwärtiger Generationenkonflikt.“
„Gut geschriebener Roman“
„›Schönwald‹ ist wie die sanftere, auf die bürgerliche, deutsche Mitte umgelegte Version der Serie ›Succession‹. Besonders gut gelingt Oehmke der Verfall des alten weißen Mannes Christopher.“
„Ein fulminanter, zeitgemäßer deutscher Familienroman.“
„Es geht um Narzissmus, Verdrängung, Schuld und Sprachlosigkeit – eine furiose Mixtur, die ›Schönwald‹ zu einem einzigartigen aktuellen Gesellschaftsroman macht.“
„Dieser Roman belegt auf bestechende Art, wozu Literatur in der Lage ist, welche Kraft und Sogwirkung das Erzählen hat. Hier ist ein großer, ein bedeutender Roman, der – und das ist bei weit über 500 Seiten ein wichtiges Merkmal – auch sehr humorvoll und mit blitzenden Dialogen unterhält, ein Roman, wie es ihn nicht sehr oft gibt.“
„Ein packender Familien- und Gesellschaftsroman, der viele Themen unserer Zeit aufnimmt, von Identitätspolitik bis zum Trumpismus. Und der zugleich tief in die bundesrepublikanische Vergangenheit führt.“
„Getreu den US-amerikanischen Vorbildern lässt Oehmke die Erzählperspektive in seinem Roman häufig wechseln und fördert bei all seinen Figuren nach und nach abstruse Abgründe zutage.“
„Ein wunderbares Buch.“
„Ein gnadenloser Roman über die lähmende Kraft des schlechten Gewissens.“
„Ein tragisch-komisches Familienpanorama, das den Zeitgeist einfängt und bis zur letzten Seite zu unterhalten weiß.“
„Mit feiner Beobachtungsgabe spießt der Autor die typischen Eigenschaften der internationalen Hipster-Gesellschaft auf.“
„Die offenen und verdeckten Demütigungen und Kränkungen, die sich die Familienmitglieder antun, werden von Oehmke eindrucksvoll beschrieben.“
„Seit Jahren hat es kein deutscher Autor geschafft, gesellschaftliche und politische Stimmungen derart packend und gleichzeitig unterhaltsam darzustellen.“
„Philipp Oehmke schaut hinter die Türen einer deutschen Durchschnittsfamilie, deckt auf, was eigentlich geheim bleiben sollte und übt dabei gleichzeitig ziemlich viel Gesellschaftskritik.“
„›Schönwald‹ ist ein moderner Familienroman, der den Bogen spannt von der BRD bis zu den USA unter Trump.“
„Philipp Oehmke kann erzählen – und das sogar richtig beeindruckend. Er hat seine groß angelegte Familiengeschichte der Verlierer bewusst zugespitzt und alle Figuren ungebremst gegen die Wand laufen lassen.“
„Philipp Oehmke (…) legt mit seinem Roman ein kurzweiliges, gegenwartspralles und durchwegs lesenswertes Buch vor.“
„Er ist ein kraftvoller, übersprudelnder Erzähler, er liebt die zugespitzte Situationskomik, hat ein Talent für pointierte Dialoge und durchleuchtet dennoch seine Protagonisten psychologisch sehr genau.“
„Der Familienroman ist die Königsklasse. Er erzählt alles. Oehmkes Buch ist eine Sensation.“
„Clever fügt er die Geschichten der einzelnen Figuren zu einem unterhaltsamen Abriss deutscher bildungsbürgerlicher Saturiertheit zusammen: Alle sprechen, ohne etwas zu sagen.“






































Pop-Literatur der 2020er vom Feinsten!
Hallo Herr Oehmke, vielen Dank für die Kurzweil, die Ihr Roman mir bereitet hat. Ich war die ganze Zeit fasziniert und angewidert zugleich. Fasziniert über die Gründlichkeit, eine Familie zu sezieren, wenn auch der Sinn sich mir nicht erschließt. Eine funktionierende und "glückliche" Familie zu entlarven, ist müßig. Immer wird es Enttäuschungen geben, weil wir 'Familie' gerne heroisieren und dadurch die Erwartungen zu hoch ansetzen. Die wenigsten gehen liebevoll und offen miteinander um und schaffen eine starke Bindung mit genügend Freiheit für die anderen. Oder es endet im absurden Theater, wie in Ihrem Roman. Angewidert war ich ununterbrochen von den ständig aufblitzenden Grundsätzen im Denken, Urteilen, Handeln etc. Daher meine Überschrift; ich bedauere Sie aufrichtig, so viel über 'was man so denkt', 'wie man so urteilt' zu wissen. Es kann nur daher kommen, dass Sie entweder selbst schon in dieser Blase des 'Bescheidwissens' lebten oder aber es sich antun mussten, das alles zu lernen, was über die gesellschaftlichen Maßstäbe in Talkshows, Feuilletons, Debattierclubs und Szenelokalen geäußert wird. Das muss hart gewesen sein. Auch, wenn Sie vieles davon durch Perspektivwechsel relativierten, es blieb doch Blasenwissen, Blasenmeinung, Blasenurteil. Ich hätte mich über weniger Schubläden gefreut. Wenn nicht alles nach Aussage (selbst Bennis Auto ein Statement) geschrien hätte. Daher hatte ich den Eindruck, Sie suchten den Applaus der 'Szene', der Blase. Meinen Applaus bekommen Sie dafür, mich unterhalten zu haben. Aber bitte schreiben Sie beim nächsten Buch etwas eigenes, echtes, überraschendes.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.